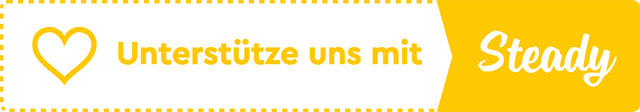Wenn man nach Unterschieden zwischen dem BVB und Kovac und dem unter Ex-Trainer Sahin sucht, kommt ein Thema immer wieder schnell auf den Tisch: der Fitnesszustand. In der Tat, auch ohne Einsicht in die Laktattests hat man als Fan den Eindruck, dass es um den konditionellen Zustand der Spieler nicht zum Besten bestellt war. In vielen Spielen der Hinrunde spürte man einen deutlichen Leistungsabfall um die 70. Minute herum, nur selten konnten die Spieler zum Ende hin noch etwas zulegen. Im Gegensatz dazu war die Mannschaft in der letzten Zeit wieder in der Lage, bis zum Abpfiff alle notwendigen Wege mitzugehen und auf diesem Wege auch knappe Vorsprünge über die Zeit zu spielen. Die Frage ist: Wer trägt Schuld daran? Liegt es nur an der täglichen Arbeit in Brackel oder haben die Spieler auch eine gewisse Eigenverantwortung für ihre individuelle Fitness?
Zwei Sachen vorweg: In der Trainingslehre hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Das ist auch notwendig, weil die körperlichen Ansprüche an die Spieler deutlich gestiegen sind. Liefen Spieler in den 70er Jahren rund sechs Kilometer pro Spiel, hat sich dieser Wert inzwischen verdoppelt. Zusätzlich hat der Wert der intensiven Sprints um mehr als 30 % zugelegt. Gleichzeitig ist die Anzahl der Saisonspiele für Kicker, die neben dem Einsatz in der Liga noch im Europapokal und für ihre Nationalmannschaften tätig sind, auf um die 60 Spiele gestiegen. Die Belastungsgrenze im Profifußball hat sich deutlich verschoben und wenn der Stammtisch heute fordert, dass die Kicker im Magathstyle mit Medizinbällen bewaffnet täglich bis zum Kotzen Hügel rauf und runter rennen sollten, damit sie anständig in Form sind, fordert nichts anderes als die Produktion kaputter und verletzter Spieler. Ein richtiges Training für Profis muss von Profis gesteuert und überwacht werden – ebenso müssen Trainingsmethoden laufend geprüft und aktualisiert werden.
Kaum Vorbereitung und laufintensive Taktik

Zum anderen muss man auch feststellen, dass die Voraussetzungen für konditionelles Arbeiten für den BVB in der Sommerpause nicht die besten waren. Durch das Champions League-Finale dauerte die reguläre Saison länger als bei anderen Teams. Danach kam die Europameisterschaft, gefolgt von einer USA-Reise, die schon damals unter diesem Gesichtspunkt kritisch gesehen wurde. Fehlende Ruhezeiten, Reisestrapazen, Trainerwechsel – dieser Dreiklang ist pures Gift, wenn man die Mannschaft konditionell in einen Zustand bringen muss, von dem sie bis mindestens zur Winterpause zehren kann. Dass man nicht in Topform in die Saison gegangen ist, ist fast zwangsläufig und muss nicht unbedingt darauf schließen, dass man in der Vorbereitung in diesem Punkt auffallen schlecht gearbeitet hat. Vielleicht hat man eben unter den gegebenen Umständen das Bestmögliche herausgeholt.
Wenn dem so wäre, ist aber wenig nachvollziehbar, dass Sahin dann ausgerechnet auf ein sehr laufintensives Spiel gesetzt hat. Die hochstehende Abwehrkette ist nur spielbar, wenn der Gegner schon im Aufbau unter Druck gesetzt wird und alle Mannschaftsteile permanent verschieben. Häufig genug passierte das nicht und andere Mannschaften konnten mit zwei, drei schnellen Bällen frei vor unserem Tor auftauchen. Der Anfang einer auch selbst verschuldeten Spirale. Mit steigender Belastung stieg die Zahl von Verletzungen. Teilweise fehlten bis zu neun Kaderspieler. Gleichzeitig erwies sich die Strategie, die hinteren Kaderplätze mit Spielern aus der U19 aufzufüllen, als wenig durchdacht. Die Tatsache, dass Sahin lieber „erwachsene“ Profis positionsfremd verschob, statt auf die „jungen Wilden“ zu setzen, lässt darauf schließen, dass sich ihre Qualität im täglichen Profitraining als doch nicht ausreichend herausstellte. Ohne diesen jungen Spielern was zu wollen, aber dass sie gerade in der dritten Liga gegen den Abstieg spielen, statt die „Amas“ auf ein höheres Niveau zu heben, verhärtet diesen Verdacht. Zusammengefasst: eine laufintensive Spielweise, permanente englische Wochen und kaum Rotationsmöglichkeiten. Warum Sahin unter diesen Umständen nicht auf eine weniger aufwändigere Spielweise umstellte, bleibt sein Geheimnis und ist ihm und seinem Team sicherlich anzulasten.
Eigenverantwortung der Spieler
Aber wie sieht es mit der Eigenverantwortung der Spieler aus? Ihr Körper ist ihr Werkzeug für die tägliche Arbeit und es sicherlich nicht zu viel verlangt, dass sie ihn in einer Form halten, in dem sie für den Verein einen Gegenwert für die hohen Gehälter bieten können. Es bestehen zumindest Zweifel, dass das auch in einem ausreichenden Maße geschehen ist.
Fangen wir gleich mit dem offensichtlichsten Fall an: Niklas Süle. Auch ganz ohne fiese Sprüche und Bodyshaming ist es offenkundig, dass Süle in der Vergangenheit hier in den Spielpausen seinen Verpflichtungen oft nicht nachgekommen ist. Ein Umstand, den er zum einen offen zugibt, der zum anderen aber auch aus seiner Zeit in München bekannt ist. Allerdings haben sich genau zu diesem Saisonstart die meisten Fans erfreut gewundert, weil Süle körperlich einen deutlich fitteren Eindruck gemacht hat, als auf manchen erschreckenden Fotos in der Zeit davor. Bei seinen Mannschaftskollegen lässt sich dagegen der konditionelle Zustand zum Start der Saison von außen wenig einschätzen. Die Frage muss aber erlaubt sein, wer dafür die Verantwortung trägt. Der Spieler oder der Verein?
Für alles andere lässt sich Für und Wider finden. Zum einen haben die Spieler sowohl die zeitlichen als auch die finanziellen Kapazitäten, um sich mit persönlichen Coaches in Topform zu bringen und zu halten. Das kann von einem Profisportler durchaus verlangt werden. Den Vereinen würde es helfen, weil die Zeit, die für konditionelles Arbeiten aufgewendet werden muss, Zeit ist, die für die Schulung im spielerischen und taktischen Bereich fehlt.
Gleichzeitig kann man aber auch sagen, dass es für den Verein ein großes Interesse sein muss, diese Arbeit selbst zu kontrollieren und zu steuern, um Fehlentwicklungen zu vermeiden. Ein falsches Training kann auf Dauer ebenso zu schweren Verletzungen führen wie zu wenig. Man wäre hier also von der Qualität externer Coaches abhängig und würde ein großes Risiko eingehen. Ganz davon abgesehen, dass man den Spielern vertrauen müsste, privat wirklich intensiv zu arbeiten. Man kann nicht bei allen Profis sicher sein, dass sie sich von Coaches zu Arbeit bewegen lassen, zu der sie keine Lust haben, wenn sie dem Coach das Gehalt zahlen.

Die Wahrheit liegt vermutlich in der Mitte. Die Spieler müssen sich eigenverantwortlich so fit halten, dass sie jederzeit im Training auf professionellem Niveau mithalten können. Zum Ende der Sommerpause bedeutet das dann eben, dass sie sich über die spielfreie Zeit hinweg selbst in einen Zustand gebracht haben, mit dem sie die harten Einheiten der Saisonvorbereitung ansatzlos mitmachen und dort auf den konditionellen Peak gebracht werden können, von dem sie im Verlauf der Saison zehren. Diese Grundlagen müssen die Kicker selbst bringen und erhalten.
Dass das immer und bei jedem Spieler der Fall ist, muss man fast schon bezweifeln, wenn man mit Verwunderung Spieler staunend und bewundernd über Kollegen sprechen hört, weil sie Extraschichten einlegen und auch abseits der Trainingseinheiten an sich arbeiten. Das sollte eigentlich für alle Profis eine Selbstverständlichkeit sein.
Wohl auch deshalb dürfte Niko Kovac für die nächste Saison der richtige Mann auf der Trainerbank sein. Die Voraussetzungen werden für die Vorbereitung auf die neue Saison angesichts Nations League-Finalrunde und Club WM nicht besser und er hat aktuell bewiesen, dass er auch im laufenden Betrieb in diesem Bereich erfolgreich arbeiten kann. Zudem gilt er als jemand, der auf strikte Disziplin setzt. Das mag jetzt nicht gerade aus dem Lehrbuch für moderne Personalführung stammen und damit ist er auf seinen letzten Stationen in Spielerkreisen auch deutlich angeeckt, aber es dürfte im Kader mehr als einen Spieler geben, der genau das braucht, um seinen eigenen Anteil dazu zu leisten.